ÜBER DAS PHOTOMETRISCHE VERHALTEN EINIGER RW
AURIGAE-STERNE
von C. HOFFMEISTER, Sonneberg
Ein typischer RW Aurigae-Stern ist ein Veränderlicher mit raschem
unperiodischem Lichtwechsel im Umfang von 1 bis 4 Grössenklassen. Die
Lichtänderungen dauern entweder ohne langere Unterbrechungen an, oder sie
werden durch langere Zeiten des Stillstands oder geringen langsamen
Lichtwechsels abgelöst. Charakteristisch für die Klasse von Veränderlichen ist
jedoch die grosse Variationsbreite ihres Verhaltens. Die typischen Falle sind
relativ selten; daneben aber gibt es eine grosse Anzahl von Sternen, denen ein
typischer Merkmal fehlt, das heisst also solche mit relativ langsamen
Lichtwechsel oder aber solche mit kleiner Amplitude bei sonst typischem
Verhalten. Dadurch entsteht eine Unsicherheit der Zuordnung, die noch
verstärkt wird durch die ebenso variables spektroskopischen Befunde,
einschliesslich jenen über die Leuchtkraftklassen, und die nicht weniger
widersprechenden Beziehungen zur interstellaren Materie, insbesondere den
Dunkelwolken. Auf these Verhältnisse soll hier nicht eingegangen
werden. Eine kurze Zusammenstellung der statistischen Daten habe ich auf
den Symposium Über "Non-stable Stars" bei der Versammlung der Internationalen
Astronomischen Union in Dublin gegeben [1]. Neben den atypischen Fallen
der oben bezeichneten Art gibt es rock die Algolähnliche Variante mit
ranch ablaufenden, aperiodisch auftretenden Lichtschwachungen aus einem
mehr oder minder gut eingehaltenen hellen "Normallichte" und
die U Geminorum ähnliche Variante, gewissermassen eine Umkehrung der
vorgenannten Untergruppe.
Es sei dabei festgestellt, dass auch bei den typischen Sternen die
"Ruhehelligkeit" im Maximum, im Minimum oder irgendwo dazwischen liegen
kann, und dass im Einzelfall die Tendez besteht, bestimmte Lagen der
Ruhehelligkeit immer wieder einzuhalten.
Die im Vorstehenden dargelegten unklaren Verhältnisse spiegeln sich
wieder in der Namensgebung. Folgende Bezeichnungen findet man in der
Literatur:
RW Aurigae-Sterne Orion-Veränderliche
RR Tauri-Sterne Nova-ähnliche Veränderliche
T Tauri-Sterne Hauptreihen-Veränderliche
Nebelveränderliche
Dabei decken sick die einzelnen so bezeichneten Gruppen nicht unbedingt.
Der Name T Tauri-Sterne, von Joy eingeführt, bezeichnet z. B. nur eine
engumrissene Untergruppe von bestimmten spektralen Eigenschaften:
Spektrum G mit Emissionslinien. Photometrisch ist T Tauri ein atypischer
Fall und ein Schulbeispiel dafür, wie schwierig und unsicher die Zuordnung
sein kann. Nach Ludendorff erinnert er in seinem Verhalten an R Coronae
Borealis, mit im allgemeinen langsamen Lichtänderungen. Auf meine Veranlassung
hat mein Mitarbeiter Paul Ahnert den Stern auf Sonneberger Platten
der Photographischen Himmelsüberwachung in der Zeit von 1930 bis 1955
untersucht. Der Lichtwechsel war immer langsam mit einer einzigen Ausnahme:
im September 1934 zeigte der Stern rasche Lichtänderungen im
Umfang von 0.6 Grössenklassen und verriet dadurch auch photometrisch
seine Verwandtschaft zur RW Aurigae-Klasse. Die Frage jedoch, inwieweit
Sterne, die photometrisch zum RW Aurigae-Typus gezahlt werden müssen,
spektral aber stark abweichen, z. B. der photometrisch sehr ähnliche Stern
T Orionis mit den Spektren A0, hinsichtlich der Ursachen des Lichtwechsels
gleichartig sind mit jenen typischen RW Aurigae-Sternen mit T Tauri-Charakter,
ist völlig offen.
Ebenso zweifelhaft sind noch die Beziehungen der Veränderlichen
in der Taurus-Dunkelwolke, meist K- und M-Sterne mit Emissionslinien, und
der schwachen Veränderlichen im Grossen Orion-Nebel zur RW Aurigae-Klasse.
Damit ist die Problematik in grossen Zügen aufgezeigt.
Zugleich wird die grosse Bedeutung sichtbar, die beim gegenwärtigen
Stande der Erkenntnis der Sammlung weiteren Erfahrungsmaterials zukommt.
Das bezieht sich keineswegs nur auf die sehr lückenhafte Bestimmung
der Spektren, sondern ebenso sehr auf die Statistik der Sterne und auf die
Erforschung der photometrischen Eigenschaften im Einzelfalle. Man beachte,
dass der Beobachter hier in einer viel weniger günstigen Lage ist als bei den
weitaus meisten Veränderlichen anderer Art. Bei den periodischen
Veränderlichen lassen sich die Zyklen aufeinander reduzieren, und die mittlere
Lichtkurve kennzeichnet das Objekt hinreichend. Unperiodischer Lichtwechsel
aber verläuft in der Regel langsam, und eine mehrtätige Unterbrechung der
Beobachtungsreihe schadet nichts. Ein unperiodisch-raschwechselnder Stern
dagegen müsste eine Reihe von Tagen hindurch ohne Unterbrechung beobachtet
werden, wenn man seine Eigenschaften kennenlernen will; man kann
seine Lichtkurve nicht, wie bei anderen Veränderlichen, aus
Bruchstücken zusammensetzen.
Ich hatte deshalb beschlossen, meinen Aufenthalt in Südwestafrika von
Juli 1952 bis Juli 1953 u. a. dafür auszunutzen, möglichst vollständige
Lichtkurven von einigen RW Aurigae-Sternen visuell zu beobachten, wofür das
fast ideal gute Klima dieses Landes die besten Voraussetzungen bot. Zugleich
aber sollte jeweils um die Neumondzeit eine Kette von Beobachtern rings
um die Erde mitwirken, damit man die Lichtkurven auch für diejenigen
Stunden zeichnen konnte, zu denen in Südafrika Tageslicht herrschte.
Trotz einiger Ausfälle ist das Ziel erreieht worden. Besonders danke
ich der Variable Star Section of the Royal New Zealand Astronomical Society.
Folgende Beobachter waren beteiligt:
F. M. Bateson Aviatu, Rarotonga, Cook Islands
A. F. Jones Timaru, New Zealand
D. A. Philpott Okuku, New Zealand
S. C. Venter Pretoria, Union of South Africa.
Als besonders günstig erwies sich der Umstand, dass das Wetter auf
Neuseeland viel besser war als ich erwartet hatte; so ist es möglich gewesen,
für eine Reihe von Neumondperioden praktisch lückenlose Lichtkurven mehrerer
Sterne über jeweils 10 bis 20, Tage hinweg zu erhalten. Insgesamt standen 6010
Helligkeitswerte für 9 Sterne zur Verfügung, wobei jedoch die interkontinentale
Zusammenarbeit auf 5 ausgesuchte Falle konzentriert war, die mit 4789
Beobachtungen beteiligt sind. Auf T Chamaeleontis, einer ausserordentlich
charakteristischen, an allen Stationen zirkumpolaren RW Aurigae-Stern,
entfallen 1822 Beobachtungen.
Es folgt eine Übersicht der Ergebnisse. Eine ausführliche Darstellung
ist inzwischen erschienen, auf die wegen aller Einzelheiten verwiesen werden
muss (2).
T Chamaeleontis. Fast lückenlose Lichtkurven liegen für 9 Neumondperioden
1952-53 von, mehr lückenhafte Darstellungen aus den folgenden Jahren, da die
Beobachter auf Neuseeland den Stern weiterhin überwacht haben. Bei einer
summarischen Betrachtung bemerkt man 3 Grundformen des Lichtwechsels:
1. Kurvenstücke, die den Eindruck völliger Regellosigkeit machen,
oft mit grosser Amplitude.
2. Quasiperiodische Wellen von mehrtagiger Lange.
3. Stillstande und Abschnitte stark verminderten Lichtwechsels.
Die Former 1 und 2 lösen einander jedoch nicht ab, sondern treten in
Überlagerung auf, indem zeitweise die eine, zeitweise die andere amplitudenmassig
überwiegt. Zu manchen Zeiten wird dieser Charakter auch bewahrt unter
Verminderung der Gesamtamplitude.
Das grösste Interesse beanspruchen die quasiperiodischen Wellen, nachdem
sick gezeigt hat, dass sie jeweils langere Zeit hindurch erhalten bleiben
und eine Darstellung der Maxima durch instantane Elemente zulassen. Nachstehende
Formeln wurden abgeleitet, wobei die Anzahl der Maxima mitangegeben ist:
I. M = 243 4251.3+3.4375d E 8 Maxima
II. M = 243 4325.1+4.1800d E 6 "
III. M = 243 4359.0+3.2323d E 26 "
Während der letzten Neumondperiode scheint der Wert P = 4.8d angedeutet,
ist aber zu schwach gestützt. In der späteren Zeit wird einmal P = 3.1d
erkennbar. Vier Ruhezeiten von 8d bis 120d Dauer sind belegt, sie beanspruchen
etwa 15% Beobachtungszeit. Der Stern scheint zwei Ruhehelligkeiten zu
bevorzugen; die hellere mit 10.8m liegt wenig unter dem Maximallicht und kann
praktisch als mit diesem identisch angesehen werden, die schwächere, 12.7m,
liegt um 0.5m bis 1m über mittlerer Minimalhelligkeit. Die Gesamtamplitude
ist 10.5m bis 13.8m, wobei das schwache Extrem nur sehr selten erreicht wird.
RU Lupi. Der Stern war ausserordentlich unruhig. Die kurzen Stillstände
scheinen die Helligkeit um 10.0m zu bevorzugen bei einer Amplitude von
9.6m bis 1O.7m visuell. Im übrigen verhielt sich dieser Veränderliche ähnlich
wie T Chamaeleontis bei stark verminderter Amplitude. Auch hier wurden
quasiperiodische Wellen vorgefunden und die beiden folgenden Systeme
aufgestellt:
I. M = 243 4261.5+3.5457d E 8 Maxima
II. M = 243 4537.6+3.8375d E 7 "
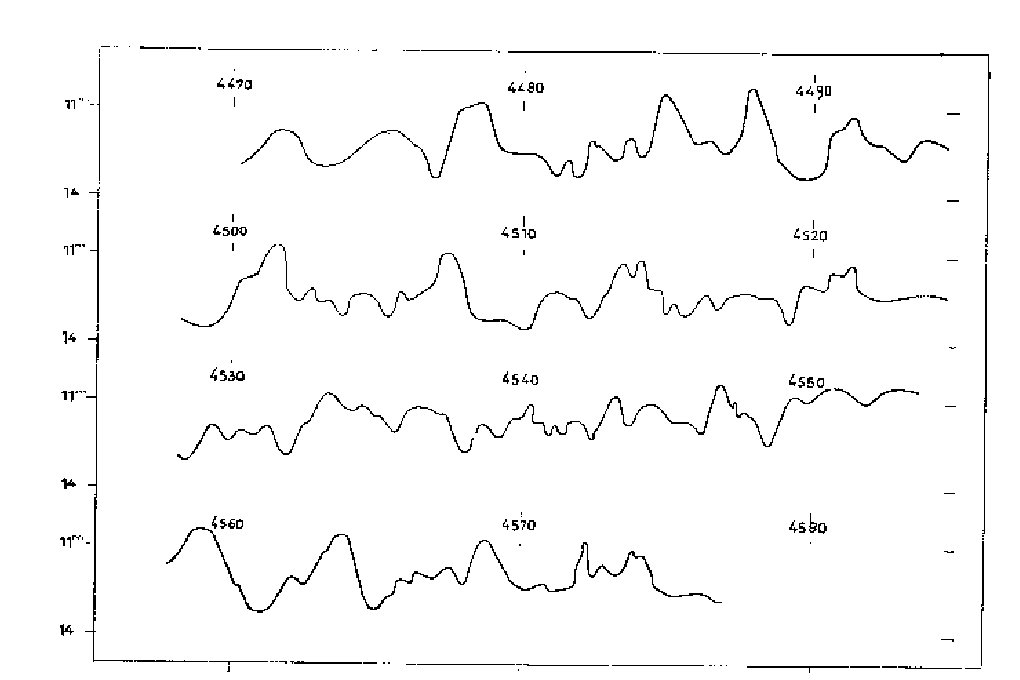 T Chamaeleontis
Die periodischen Bestandteile bestimmen die Lichtkurve jedoch in viel
geringerem Masse als bei T Chamaeleontis.
RY Lupi. Der Stern verhält sich wesentlich anders als die beiden vor dem
behandelten. Kennzeichnend sind lange Stillstände bei einer Helligkeit, die
wenig unter dem Maximum liegt. Nur selten zeigt er die typischen starken
Schwankungen mit Amplituden bis zu 2m. Erhebungen über das bei 9.8m bis
10.0m liegende "Normallicht" sind selten, spitze Minima von sehr verschiedener
Breite und Tiefe dagegen haufig. Der Veränderliche steht damit zwischen
den Prototypen RR Tauri und dem "algolähnlichen" BO Cephei nach der
Typologie von Schneller [3]. Periodische Wellen sind selten; wo sie aber
angedeutet sind, haben die Zyklen wieder eine Lange von 3 bis 4d. Dem
Charakter des Sterns entsprechend sind es die Minima, die periodisch auftreten.
In einem der Abschnitte ist der Lichtwechsel völlig regellos.
AK Scorpii. Während der Beobachtungsperiode 1937-38 zeigte dieser Stern
Verwandtschaft zu den "algolähnlichen" Veränderliehen. Die Beobachtungsreihe
1952-53 lasst ein anderes Verhalten erkennen. Der Lichtwechsel weist von
10d bis 15d Lange auf, denen kleine rasche Schwankungen überlagert
sind. Eine Periodizität der letzteren ist kaum erkennbar; die Zyklen von
1d bis 3d Lange unterliegen einem raschen Wechsel. Zeitweilig fehlen sie, und
die Lichtkurve verläuft über eine Reihe von Tagen glatt.
Y Leporis. Dieser Stern mit dem Spektrum M 4 III hatte nach dem
photographischen Material 1935 bis 1938 zeitweise rasche Änderungen und
unruhigen Verlauf der Lichtkurve gezeigt. Die visuellen Beobachtungen 1952-53
ergaben Wellen von 50d bis 60d Länge mit Amplituden von 0.4m bis 1.0m, doch
ohne Periodizität über eine grössere Anzahl von Zyklen. Die Zuordnung des
Sterns ist zweifelhaft.
Die folgenden 4 Sterne wurden nach visuellen Beobachtungen des Verfassers
allein und nach den Befunden auf photographischen Platten bearbeitet.
50.1929 = V 350 Orionis. Der Veränderliche ist ein RW Aurigae-Stern mit
mehreren Ruhehelligkeiten, sodass er sich manchmal wie ein U Geminorum-Stern,
manchmal wie ein BO Cephei-Stern verhalt. Die visuellen Beobachtungen von
1952-53 zeigten ihn nahe dem schwachen Ruhelicht ohne stärkeren Wechsel.
S 4799 Phe ist ein typischen "Algol-ähnlichere" Veränderlicher mit gut
eingehaltenem Normallicht bei 9.25m, von dem aus Erhellungen um 0.2m und
Schwächungen um 0.25m relativ selten sind. Die Amplitude ist demnach kaum
0.5m.
S 4800 Phe unterscheidet sich nur wenig von dem 0.8deg entfernt stehenden
vorbehandelten Stern. Die Amplitude ist auch nur 0.5m, die Lichtkurve aber
verläuft zeitweilig etwas unruhig.
S 4801 Phe gehört zu derselben Gruppe nach Ort und Charakter. Die Amplitude
ist 10.2m bis 10.8m, der Lichtwechsel verläuft in Wellen, denen zeitweise
rasche Schwankungen von 0.2m Amplitude überlagert sind. Er ist damit
als typischen Y Leporis-Stern zu bezeichnen.
Die 9 hier beschriebenen Sterne stellen eine stetige Folge von Untertypen
dar, die von der extremen RR Tauri-Form bis zur Y Leporis-Variante reicht.
Das Vorkommen von Übergangsformen zwischen den Untertypen von Schnellers
Klassifikation scheint hier recht deutlich aufgezeigt, und wenn auch die
eingangs gestellte Frage nach den Beziehungen zwischen den photometrisch
recht unterschiedlichen Subtypen damit nicht erschöpfend beantwortet ist,
ergeben sich doch Hinweise auf mögliche, physikalisch begründete
Verwandtschaften.
Für die Theorie dürfte von Bedeutung sein, dass das Auftreten eines
hellen Ruhelichts, wie es für die BO Cephei-Sterne charakteristisch ist, doch
auch bei den eigentlichen RW Aurigae-Sternen häufiger vorkommt, als
man bisher annahm. Mit der Vorstellung, dass der Lichtwechsel, wie bei den
Flare Stars, den U Geminorum-Sternen and den Novae durch Eruptionen
hervorgebracht wird, ist dieser Befund nicht ohne weiteres vereinbar.
Endlich sei noch kurz auf die quasiperiodischen Wellen eingegangen.
Ähnliche Erscheinungen sind in der Astrophysik nicht unbekannt. Sie zeigen
sich auf dem absteigenden Ast mancher Novae und, mit grösseren Periodenwerten
bei den Veränderlichen des EM Cygni-Typus, wovon bisher aber
nur 3 Fälle bekannt sind. Auch die nahezu, aber nicht streng periodischen
CN Orionis-Sterne, die eine Untergruppe des U Geminorum-Typus darstellen,
sind heranzuziehen. Bei allen diesen Objekten handelt es sich sehr
wahrscheinlich um Hauptreihensterne.
Legt man ein Sternmodell von der Art der Sonne zugrunde, was auch
durch den Spektraltypus der T Tauri-Sterne gerechtfertigt scheint, so würde
die Periode der Eigenschwingung, falls der ganze Stern pulsiert, bei ~ 0.1d
lieges. Dass die bei RW Aurigae-Sternen beobachteten Perioden sehr viel
langer sind, kann so verstanden werden, dass nur ein Teil des Sterns pulsiert.
Man gelangt zu einer einleuchtenden Vorstellung, wenn man annimmt, dass
die Expansionen anisotrop erfolgen, also nur einen Teil der Oberfläche der
Gaskugel einbeziehen. Dies wird verständlich, wenn man Unstetigkeiten der
Energieerzeugung heranzieht in relativ oberflächennahen Schichten des
Sterns. Nur so wird hier and bei den anderen Types, die ahnliches Verhalten
zeigen, die Veränderlichkeit der Perioden zu erklären sein. Man kann nicht
annehmen, dass ein ganzer Stern sein Trägheitsmoment andert, wohl aber
dass die Partialschwingungen manchmal grössere, manchmal kleinere Teile
der ausseren Schichten des Sterns einbeziehen. Eine Beziehung zwischen
Periodenlänge and Amplitude lässt sich nicht nachweisen. Zwar scheint bei T
Chamaeleontis nach den 3 Formeln die kleinere Amplitude zur langeren
Periode zu gehören, aber die am Ende meiner Beobachtungsreihe in Erscheinung
tretende Periode von 4.8d hat gerade die grössten Amplituden von
etwa 2.5m und auch die Kurve von RU Lupi widerspricht jener Regel. Sehr
merkwürdig ist die mehrfach gut belegte Verdoppelung des Periodenwertes,
derart, dass die dazwischenliegenden Maxima entweder unterdrückt oder
sehr flack sind. Dies deutet auf die Überlagerung zweier Frequenzen hin
die sich um eine Oktave unterscheiden. Die Lichtkurve in ihrer Gesamtheit
macht den Eindruck, dass sich Partialschwingungen verschiedener Amplitude
und verschiedener Perioden auf eine sehr komplizierte Art überlagern,
dass die eine Welle abklingt and eine andere neu entsteht, dass aber in der
Endwirkung gewisse für den Stern charakteristische, d. h. von seiner Masse und
seinem Aufbau bestimmte Periodengrenzen eingehalten werden. Durch these
Vorgange könnte auch ein Rotationseffekt überdeckt oder stark verschleiert
werden. Den gesamten Lichtwechsel auf these Weise zu erklären, ist kaum
möglich in Anbetracht der grossen Amplitudes. Wenn man aber als Ursache
der Erscheinungen rasch ablaufende Unstetigkeiten der Energieerzeugung
in oberflächennahen Schichten annimmt, wird verständlich, dass daneben
turbulente Massenverlagerungen and Vorgange von der Art der Solar Flares
auftreten müssen, die zusammen mit den Partialschwingungen sind, das
Verhalten dieser Sterne unserem Verständnis näherzubringen.
Literaturhinweise
1. C. Hoffmeister, On RW Aurigae Type Stars and related Types.
International Astronomical Union Symposium No. 3, Non-stable Stars, p. 22.
2. C. Hoffmeister, Über das Verhalten von drei typischen und sechs atypischen RW
Aurigae-Sternen. Veröffentl. Sternwarte Sonneberg 3 Nr. 3, 1957.
3. H. Schneller, Geschichte und Literatur des Lichtwechsels der Veränderlichen
Sterne. Zweite Ausgabe. 3. Band p. V -IX, 1952.
T Chamaeleontis
Die periodischen Bestandteile bestimmen die Lichtkurve jedoch in viel
geringerem Masse als bei T Chamaeleontis.
RY Lupi. Der Stern verhält sich wesentlich anders als die beiden vor dem
behandelten. Kennzeichnend sind lange Stillstände bei einer Helligkeit, die
wenig unter dem Maximum liegt. Nur selten zeigt er die typischen starken
Schwankungen mit Amplituden bis zu 2m. Erhebungen über das bei 9.8m bis
10.0m liegende "Normallicht" sind selten, spitze Minima von sehr verschiedener
Breite und Tiefe dagegen haufig. Der Veränderliche steht damit zwischen
den Prototypen RR Tauri und dem "algolähnlichen" BO Cephei nach der
Typologie von Schneller [3]. Periodische Wellen sind selten; wo sie aber
angedeutet sind, haben die Zyklen wieder eine Lange von 3 bis 4d. Dem
Charakter des Sterns entsprechend sind es die Minima, die periodisch auftreten.
In einem der Abschnitte ist der Lichtwechsel völlig regellos.
AK Scorpii. Während der Beobachtungsperiode 1937-38 zeigte dieser Stern
Verwandtschaft zu den "algolähnlichen" Veränderliehen. Die Beobachtungsreihe
1952-53 lasst ein anderes Verhalten erkennen. Der Lichtwechsel weist von
10d bis 15d Lange auf, denen kleine rasche Schwankungen überlagert
sind. Eine Periodizität der letzteren ist kaum erkennbar; die Zyklen von
1d bis 3d Lange unterliegen einem raschen Wechsel. Zeitweilig fehlen sie, und
die Lichtkurve verläuft über eine Reihe von Tagen glatt.
Y Leporis. Dieser Stern mit dem Spektrum M 4 III hatte nach dem
photographischen Material 1935 bis 1938 zeitweise rasche Änderungen und
unruhigen Verlauf der Lichtkurve gezeigt. Die visuellen Beobachtungen 1952-53
ergaben Wellen von 50d bis 60d Länge mit Amplituden von 0.4m bis 1.0m, doch
ohne Periodizität über eine grössere Anzahl von Zyklen. Die Zuordnung des
Sterns ist zweifelhaft.
Die folgenden 4 Sterne wurden nach visuellen Beobachtungen des Verfassers
allein und nach den Befunden auf photographischen Platten bearbeitet.
50.1929 = V 350 Orionis. Der Veränderliche ist ein RW Aurigae-Stern mit
mehreren Ruhehelligkeiten, sodass er sich manchmal wie ein U Geminorum-Stern,
manchmal wie ein BO Cephei-Stern verhalt. Die visuellen Beobachtungen von
1952-53 zeigten ihn nahe dem schwachen Ruhelicht ohne stärkeren Wechsel.
S 4799 Phe ist ein typischen "Algol-ähnlichere" Veränderlicher mit gut
eingehaltenem Normallicht bei 9.25m, von dem aus Erhellungen um 0.2m und
Schwächungen um 0.25m relativ selten sind. Die Amplitude ist demnach kaum
0.5m.
S 4800 Phe unterscheidet sich nur wenig von dem 0.8deg entfernt stehenden
vorbehandelten Stern. Die Amplitude ist auch nur 0.5m, die Lichtkurve aber
verläuft zeitweilig etwas unruhig.
S 4801 Phe gehört zu derselben Gruppe nach Ort und Charakter. Die Amplitude
ist 10.2m bis 10.8m, der Lichtwechsel verläuft in Wellen, denen zeitweise
rasche Schwankungen von 0.2m Amplitude überlagert sind. Er ist damit
als typischen Y Leporis-Stern zu bezeichnen.
Die 9 hier beschriebenen Sterne stellen eine stetige Folge von Untertypen
dar, die von der extremen RR Tauri-Form bis zur Y Leporis-Variante reicht.
Das Vorkommen von Übergangsformen zwischen den Untertypen von Schnellers
Klassifikation scheint hier recht deutlich aufgezeigt, und wenn auch die
eingangs gestellte Frage nach den Beziehungen zwischen den photometrisch
recht unterschiedlichen Subtypen damit nicht erschöpfend beantwortet ist,
ergeben sich doch Hinweise auf mögliche, physikalisch begründete
Verwandtschaften.
Für die Theorie dürfte von Bedeutung sein, dass das Auftreten eines
hellen Ruhelichts, wie es für die BO Cephei-Sterne charakteristisch ist, doch
auch bei den eigentlichen RW Aurigae-Sternen häufiger vorkommt, als
man bisher annahm. Mit der Vorstellung, dass der Lichtwechsel, wie bei den
Flare Stars, den U Geminorum-Sternen and den Novae durch Eruptionen
hervorgebracht wird, ist dieser Befund nicht ohne weiteres vereinbar.
Endlich sei noch kurz auf die quasiperiodischen Wellen eingegangen.
Ähnliche Erscheinungen sind in der Astrophysik nicht unbekannt. Sie zeigen
sich auf dem absteigenden Ast mancher Novae und, mit grösseren Periodenwerten
bei den Veränderlichen des EM Cygni-Typus, wovon bisher aber
nur 3 Fälle bekannt sind. Auch die nahezu, aber nicht streng periodischen
CN Orionis-Sterne, die eine Untergruppe des U Geminorum-Typus darstellen,
sind heranzuziehen. Bei allen diesen Objekten handelt es sich sehr
wahrscheinlich um Hauptreihensterne.
Legt man ein Sternmodell von der Art der Sonne zugrunde, was auch
durch den Spektraltypus der T Tauri-Sterne gerechtfertigt scheint, so würde
die Periode der Eigenschwingung, falls der ganze Stern pulsiert, bei ~ 0.1d
lieges. Dass die bei RW Aurigae-Sternen beobachteten Perioden sehr viel
langer sind, kann so verstanden werden, dass nur ein Teil des Sterns pulsiert.
Man gelangt zu einer einleuchtenden Vorstellung, wenn man annimmt, dass
die Expansionen anisotrop erfolgen, also nur einen Teil der Oberfläche der
Gaskugel einbeziehen. Dies wird verständlich, wenn man Unstetigkeiten der
Energieerzeugung heranzieht in relativ oberflächennahen Schichten des
Sterns. Nur so wird hier and bei den anderen Types, die ahnliches Verhalten
zeigen, die Veränderlichkeit der Perioden zu erklären sein. Man kann nicht
annehmen, dass ein ganzer Stern sein Trägheitsmoment andert, wohl aber
dass die Partialschwingungen manchmal grössere, manchmal kleinere Teile
der ausseren Schichten des Sterns einbeziehen. Eine Beziehung zwischen
Periodenlänge and Amplitude lässt sich nicht nachweisen. Zwar scheint bei T
Chamaeleontis nach den 3 Formeln die kleinere Amplitude zur langeren
Periode zu gehören, aber die am Ende meiner Beobachtungsreihe in Erscheinung
tretende Periode von 4.8d hat gerade die grössten Amplituden von
etwa 2.5m und auch die Kurve von RU Lupi widerspricht jener Regel. Sehr
merkwürdig ist die mehrfach gut belegte Verdoppelung des Periodenwertes,
derart, dass die dazwischenliegenden Maxima entweder unterdrückt oder
sehr flack sind. Dies deutet auf die Überlagerung zweier Frequenzen hin
die sich um eine Oktave unterscheiden. Die Lichtkurve in ihrer Gesamtheit
macht den Eindruck, dass sich Partialschwingungen verschiedener Amplitude
und verschiedener Perioden auf eine sehr komplizierte Art überlagern,
dass die eine Welle abklingt and eine andere neu entsteht, dass aber in der
Endwirkung gewisse für den Stern charakteristische, d. h. von seiner Masse und
seinem Aufbau bestimmte Periodengrenzen eingehalten werden. Durch these
Vorgange könnte auch ein Rotationseffekt überdeckt oder stark verschleiert
werden. Den gesamten Lichtwechsel auf these Weise zu erklären, ist kaum
möglich in Anbetracht der grossen Amplitudes. Wenn man aber als Ursache
der Erscheinungen rasch ablaufende Unstetigkeiten der Energieerzeugung
in oberflächennahen Schichten annimmt, wird verständlich, dass daneben
turbulente Massenverlagerungen and Vorgange von der Art der Solar Flares
auftreten müssen, die zusammen mit den Partialschwingungen sind, das
Verhalten dieser Sterne unserem Verständnis näherzubringen.
Literaturhinweise
1. C. Hoffmeister, On RW Aurigae Type Stars and related Types.
International Astronomical Union Symposium No. 3, Non-stable Stars, p. 22.
2. C. Hoffmeister, Über das Verhalten von drei typischen und sechs atypischen RW
Aurigae-Sternen. Veröffentl. Sternwarte Sonneberg 3 Nr. 3, 1957.
3. H. Schneller, Geschichte und Literatur des Lichtwechsels der Veränderlichen
Sterne. Zweite Ausgabe. 3. Band p. V -IX, 1952.
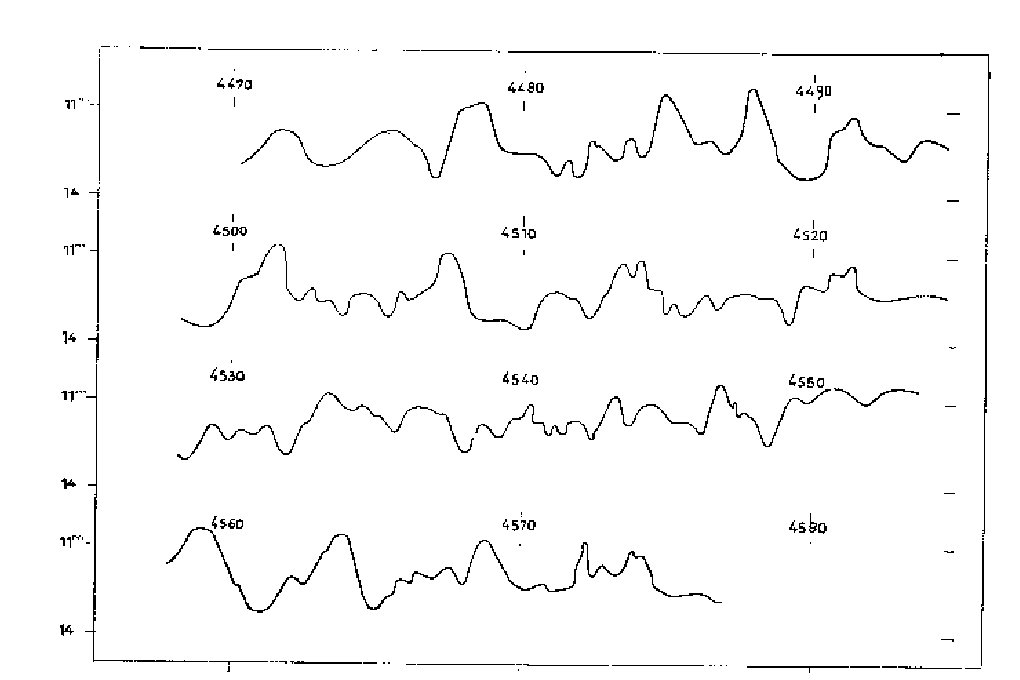 T Chamaeleontis
Die periodischen Bestandteile bestimmen die Lichtkurve jedoch in viel
geringerem Masse als bei T Chamaeleontis.
RY Lupi. Der Stern verhält sich wesentlich anders als die beiden vor dem
behandelten. Kennzeichnend sind lange Stillstände bei einer Helligkeit, die
wenig unter dem Maximum liegt. Nur selten zeigt er die typischen starken
Schwankungen mit Amplituden bis zu 2m. Erhebungen über das bei 9.8m bis
10.0m liegende "Normallicht" sind selten, spitze Minima von sehr verschiedener
Breite und Tiefe dagegen haufig. Der Veränderliche steht damit zwischen
den Prototypen RR Tauri und dem "algolähnlichen" BO Cephei nach der
Typologie von Schneller [3]. Periodische Wellen sind selten; wo sie aber
angedeutet sind, haben die Zyklen wieder eine Lange von 3 bis 4d. Dem
Charakter des Sterns entsprechend sind es die Minima, die periodisch auftreten.
In einem der Abschnitte ist der Lichtwechsel völlig regellos.
AK Scorpii. Während der Beobachtungsperiode 1937-38 zeigte dieser Stern
Verwandtschaft zu den "algolähnlichen" Veränderliehen. Die Beobachtungsreihe
1952-53 lasst ein anderes Verhalten erkennen. Der Lichtwechsel weist von
10d bis 15d Lange auf, denen kleine rasche Schwankungen überlagert
sind. Eine Periodizität der letzteren ist kaum erkennbar; die Zyklen von
1d bis 3d Lange unterliegen einem raschen Wechsel. Zeitweilig fehlen sie, und
die Lichtkurve verläuft über eine Reihe von Tagen glatt.
Y Leporis. Dieser Stern mit dem Spektrum M 4 III hatte nach dem
photographischen Material 1935 bis 1938 zeitweise rasche Änderungen und
unruhigen Verlauf der Lichtkurve gezeigt. Die visuellen Beobachtungen 1952-53
ergaben Wellen von 50d bis 60d Länge mit Amplituden von 0.4m bis 1.0m, doch
ohne Periodizität über eine grössere Anzahl von Zyklen. Die Zuordnung des
Sterns ist zweifelhaft.
Die folgenden 4 Sterne wurden nach visuellen Beobachtungen des Verfassers
allein und nach den Befunden auf photographischen Platten bearbeitet.
50.1929 = V 350 Orionis. Der Veränderliche ist ein RW Aurigae-Stern mit
mehreren Ruhehelligkeiten, sodass er sich manchmal wie ein U Geminorum-Stern,
manchmal wie ein BO Cephei-Stern verhalt. Die visuellen Beobachtungen von
1952-53 zeigten ihn nahe dem schwachen Ruhelicht ohne stärkeren Wechsel.
S 4799 Phe ist ein typischen "Algol-ähnlichere" Veränderlicher mit gut
eingehaltenem Normallicht bei 9.25m, von dem aus Erhellungen um 0.2m und
Schwächungen um 0.25m relativ selten sind. Die Amplitude ist demnach kaum
0.5m.
S 4800 Phe unterscheidet sich nur wenig von dem 0.8deg entfernt stehenden
vorbehandelten Stern. Die Amplitude ist auch nur 0.5m, die Lichtkurve aber
verläuft zeitweilig etwas unruhig.
S 4801 Phe gehört zu derselben Gruppe nach Ort und Charakter. Die Amplitude
ist 10.2m bis 10.8m, der Lichtwechsel verläuft in Wellen, denen zeitweise
rasche Schwankungen von 0.2m Amplitude überlagert sind. Er ist damit
als typischen Y Leporis-Stern zu bezeichnen.
Die 9 hier beschriebenen Sterne stellen eine stetige Folge von Untertypen
dar, die von der extremen RR Tauri-Form bis zur Y Leporis-Variante reicht.
Das Vorkommen von Übergangsformen zwischen den Untertypen von Schnellers
Klassifikation scheint hier recht deutlich aufgezeigt, und wenn auch die
eingangs gestellte Frage nach den Beziehungen zwischen den photometrisch
recht unterschiedlichen Subtypen damit nicht erschöpfend beantwortet ist,
ergeben sich doch Hinweise auf mögliche, physikalisch begründete
Verwandtschaften.
Für die Theorie dürfte von Bedeutung sein, dass das Auftreten eines
hellen Ruhelichts, wie es für die BO Cephei-Sterne charakteristisch ist, doch
auch bei den eigentlichen RW Aurigae-Sternen häufiger vorkommt, als
man bisher annahm. Mit der Vorstellung, dass der Lichtwechsel, wie bei den
Flare Stars, den U Geminorum-Sternen and den Novae durch Eruptionen
hervorgebracht wird, ist dieser Befund nicht ohne weiteres vereinbar.
Endlich sei noch kurz auf die quasiperiodischen Wellen eingegangen.
Ähnliche Erscheinungen sind in der Astrophysik nicht unbekannt. Sie zeigen
sich auf dem absteigenden Ast mancher Novae und, mit grösseren Periodenwerten
bei den Veränderlichen des EM Cygni-Typus, wovon bisher aber
nur 3 Fälle bekannt sind. Auch die nahezu, aber nicht streng periodischen
CN Orionis-Sterne, die eine Untergruppe des U Geminorum-Typus darstellen,
sind heranzuziehen. Bei allen diesen Objekten handelt es sich sehr
wahrscheinlich um Hauptreihensterne.
Legt man ein Sternmodell von der Art der Sonne zugrunde, was auch
durch den Spektraltypus der T Tauri-Sterne gerechtfertigt scheint, so würde
die Periode der Eigenschwingung, falls der ganze Stern pulsiert, bei ~ 0.1d
lieges. Dass die bei RW Aurigae-Sternen beobachteten Perioden sehr viel
langer sind, kann so verstanden werden, dass nur ein Teil des Sterns pulsiert.
Man gelangt zu einer einleuchtenden Vorstellung, wenn man annimmt, dass
die Expansionen anisotrop erfolgen, also nur einen Teil der Oberfläche der
Gaskugel einbeziehen. Dies wird verständlich, wenn man Unstetigkeiten der
Energieerzeugung heranzieht in relativ oberflächennahen Schichten des
Sterns. Nur so wird hier and bei den anderen Types, die ahnliches Verhalten
zeigen, die Veränderlichkeit der Perioden zu erklären sein. Man kann nicht
annehmen, dass ein ganzer Stern sein Trägheitsmoment andert, wohl aber
dass die Partialschwingungen manchmal grössere, manchmal kleinere Teile
der ausseren Schichten des Sterns einbeziehen. Eine Beziehung zwischen
Periodenlänge and Amplitude lässt sich nicht nachweisen. Zwar scheint bei T
Chamaeleontis nach den 3 Formeln die kleinere Amplitude zur langeren
Periode zu gehören, aber die am Ende meiner Beobachtungsreihe in Erscheinung
tretende Periode von 4.8d hat gerade die grössten Amplituden von
etwa 2.5m und auch die Kurve von RU Lupi widerspricht jener Regel. Sehr
merkwürdig ist die mehrfach gut belegte Verdoppelung des Periodenwertes,
derart, dass die dazwischenliegenden Maxima entweder unterdrückt oder
sehr flack sind. Dies deutet auf die Überlagerung zweier Frequenzen hin
die sich um eine Oktave unterscheiden. Die Lichtkurve in ihrer Gesamtheit
macht den Eindruck, dass sich Partialschwingungen verschiedener Amplitude
und verschiedener Perioden auf eine sehr komplizierte Art überlagern,
dass die eine Welle abklingt and eine andere neu entsteht, dass aber in der
Endwirkung gewisse für den Stern charakteristische, d. h. von seiner Masse und
seinem Aufbau bestimmte Periodengrenzen eingehalten werden. Durch these
Vorgange könnte auch ein Rotationseffekt überdeckt oder stark verschleiert
werden. Den gesamten Lichtwechsel auf these Weise zu erklären, ist kaum
möglich in Anbetracht der grossen Amplitudes. Wenn man aber als Ursache
der Erscheinungen rasch ablaufende Unstetigkeiten der Energieerzeugung
in oberflächennahen Schichten annimmt, wird verständlich, dass daneben
turbulente Massenverlagerungen and Vorgange von der Art der Solar Flares
auftreten müssen, die zusammen mit den Partialschwingungen sind, das
Verhalten dieser Sterne unserem Verständnis näherzubringen.
Literaturhinweise
1. C. Hoffmeister, On RW Aurigae Type Stars and related Types.
International Astronomical Union Symposium No. 3, Non-stable Stars, p. 22.
2. C. Hoffmeister, Über das Verhalten von drei typischen und sechs atypischen RW
Aurigae-Sternen. Veröffentl. Sternwarte Sonneberg 3 Nr. 3, 1957.
3. H. Schneller, Geschichte und Literatur des Lichtwechsels der Veränderlichen
Sterne. Zweite Ausgabe. 3. Band p. V -IX, 1952.
T Chamaeleontis
Die periodischen Bestandteile bestimmen die Lichtkurve jedoch in viel
geringerem Masse als bei T Chamaeleontis.
RY Lupi. Der Stern verhält sich wesentlich anders als die beiden vor dem
behandelten. Kennzeichnend sind lange Stillstände bei einer Helligkeit, die
wenig unter dem Maximum liegt. Nur selten zeigt er die typischen starken
Schwankungen mit Amplituden bis zu 2m. Erhebungen über das bei 9.8m bis
10.0m liegende "Normallicht" sind selten, spitze Minima von sehr verschiedener
Breite und Tiefe dagegen haufig. Der Veränderliche steht damit zwischen
den Prototypen RR Tauri und dem "algolähnlichen" BO Cephei nach der
Typologie von Schneller [3]. Periodische Wellen sind selten; wo sie aber
angedeutet sind, haben die Zyklen wieder eine Lange von 3 bis 4d. Dem
Charakter des Sterns entsprechend sind es die Minima, die periodisch auftreten.
In einem der Abschnitte ist der Lichtwechsel völlig regellos.
AK Scorpii. Während der Beobachtungsperiode 1937-38 zeigte dieser Stern
Verwandtschaft zu den "algolähnlichen" Veränderliehen. Die Beobachtungsreihe
1952-53 lasst ein anderes Verhalten erkennen. Der Lichtwechsel weist von
10d bis 15d Lange auf, denen kleine rasche Schwankungen überlagert
sind. Eine Periodizität der letzteren ist kaum erkennbar; die Zyklen von
1d bis 3d Lange unterliegen einem raschen Wechsel. Zeitweilig fehlen sie, und
die Lichtkurve verläuft über eine Reihe von Tagen glatt.
Y Leporis. Dieser Stern mit dem Spektrum M 4 III hatte nach dem
photographischen Material 1935 bis 1938 zeitweise rasche Änderungen und
unruhigen Verlauf der Lichtkurve gezeigt. Die visuellen Beobachtungen 1952-53
ergaben Wellen von 50d bis 60d Länge mit Amplituden von 0.4m bis 1.0m, doch
ohne Periodizität über eine grössere Anzahl von Zyklen. Die Zuordnung des
Sterns ist zweifelhaft.
Die folgenden 4 Sterne wurden nach visuellen Beobachtungen des Verfassers
allein und nach den Befunden auf photographischen Platten bearbeitet.
50.1929 = V 350 Orionis. Der Veränderliche ist ein RW Aurigae-Stern mit
mehreren Ruhehelligkeiten, sodass er sich manchmal wie ein U Geminorum-Stern,
manchmal wie ein BO Cephei-Stern verhalt. Die visuellen Beobachtungen von
1952-53 zeigten ihn nahe dem schwachen Ruhelicht ohne stärkeren Wechsel.
S 4799 Phe ist ein typischen "Algol-ähnlichere" Veränderlicher mit gut
eingehaltenem Normallicht bei 9.25m, von dem aus Erhellungen um 0.2m und
Schwächungen um 0.25m relativ selten sind. Die Amplitude ist demnach kaum
0.5m.
S 4800 Phe unterscheidet sich nur wenig von dem 0.8deg entfernt stehenden
vorbehandelten Stern. Die Amplitude ist auch nur 0.5m, die Lichtkurve aber
verläuft zeitweilig etwas unruhig.
S 4801 Phe gehört zu derselben Gruppe nach Ort und Charakter. Die Amplitude
ist 10.2m bis 10.8m, der Lichtwechsel verläuft in Wellen, denen zeitweise
rasche Schwankungen von 0.2m Amplitude überlagert sind. Er ist damit
als typischen Y Leporis-Stern zu bezeichnen.
Die 9 hier beschriebenen Sterne stellen eine stetige Folge von Untertypen
dar, die von der extremen RR Tauri-Form bis zur Y Leporis-Variante reicht.
Das Vorkommen von Übergangsformen zwischen den Untertypen von Schnellers
Klassifikation scheint hier recht deutlich aufgezeigt, und wenn auch die
eingangs gestellte Frage nach den Beziehungen zwischen den photometrisch
recht unterschiedlichen Subtypen damit nicht erschöpfend beantwortet ist,
ergeben sich doch Hinweise auf mögliche, physikalisch begründete
Verwandtschaften.
Für die Theorie dürfte von Bedeutung sein, dass das Auftreten eines
hellen Ruhelichts, wie es für die BO Cephei-Sterne charakteristisch ist, doch
auch bei den eigentlichen RW Aurigae-Sternen häufiger vorkommt, als
man bisher annahm. Mit der Vorstellung, dass der Lichtwechsel, wie bei den
Flare Stars, den U Geminorum-Sternen and den Novae durch Eruptionen
hervorgebracht wird, ist dieser Befund nicht ohne weiteres vereinbar.
Endlich sei noch kurz auf die quasiperiodischen Wellen eingegangen.
Ähnliche Erscheinungen sind in der Astrophysik nicht unbekannt. Sie zeigen
sich auf dem absteigenden Ast mancher Novae und, mit grösseren Periodenwerten
bei den Veränderlichen des EM Cygni-Typus, wovon bisher aber
nur 3 Fälle bekannt sind. Auch die nahezu, aber nicht streng periodischen
CN Orionis-Sterne, die eine Untergruppe des U Geminorum-Typus darstellen,
sind heranzuziehen. Bei allen diesen Objekten handelt es sich sehr
wahrscheinlich um Hauptreihensterne.
Legt man ein Sternmodell von der Art der Sonne zugrunde, was auch
durch den Spektraltypus der T Tauri-Sterne gerechtfertigt scheint, so würde
die Periode der Eigenschwingung, falls der ganze Stern pulsiert, bei ~ 0.1d
lieges. Dass die bei RW Aurigae-Sternen beobachteten Perioden sehr viel
langer sind, kann so verstanden werden, dass nur ein Teil des Sterns pulsiert.
Man gelangt zu einer einleuchtenden Vorstellung, wenn man annimmt, dass
die Expansionen anisotrop erfolgen, also nur einen Teil der Oberfläche der
Gaskugel einbeziehen. Dies wird verständlich, wenn man Unstetigkeiten der
Energieerzeugung heranzieht in relativ oberflächennahen Schichten des
Sterns. Nur so wird hier and bei den anderen Types, die ahnliches Verhalten
zeigen, die Veränderlichkeit der Perioden zu erklären sein. Man kann nicht
annehmen, dass ein ganzer Stern sein Trägheitsmoment andert, wohl aber
dass die Partialschwingungen manchmal grössere, manchmal kleinere Teile
der ausseren Schichten des Sterns einbeziehen. Eine Beziehung zwischen
Periodenlänge and Amplitude lässt sich nicht nachweisen. Zwar scheint bei T
Chamaeleontis nach den 3 Formeln die kleinere Amplitude zur langeren
Periode zu gehören, aber die am Ende meiner Beobachtungsreihe in Erscheinung
tretende Periode von 4.8d hat gerade die grössten Amplituden von
etwa 2.5m und auch die Kurve von RU Lupi widerspricht jener Regel. Sehr
merkwürdig ist die mehrfach gut belegte Verdoppelung des Periodenwertes,
derart, dass die dazwischenliegenden Maxima entweder unterdrückt oder
sehr flack sind. Dies deutet auf die Überlagerung zweier Frequenzen hin
die sich um eine Oktave unterscheiden. Die Lichtkurve in ihrer Gesamtheit
macht den Eindruck, dass sich Partialschwingungen verschiedener Amplitude
und verschiedener Perioden auf eine sehr komplizierte Art überlagern,
dass die eine Welle abklingt and eine andere neu entsteht, dass aber in der
Endwirkung gewisse für den Stern charakteristische, d. h. von seiner Masse und
seinem Aufbau bestimmte Periodengrenzen eingehalten werden. Durch these
Vorgange könnte auch ein Rotationseffekt überdeckt oder stark verschleiert
werden. Den gesamten Lichtwechsel auf these Weise zu erklären, ist kaum
möglich in Anbetracht der grossen Amplitudes. Wenn man aber als Ursache
der Erscheinungen rasch ablaufende Unstetigkeiten der Energieerzeugung
in oberflächennahen Schichten annimmt, wird verständlich, dass daneben
turbulente Massenverlagerungen and Vorgange von der Art der Solar Flares
auftreten müssen, die zusammen mit den Partialschwingungen sind, das
Verhalten dieser Sterne unserem Verständnis näherzubringen.
Literaturhinweise
1. C. Hoffmeister, On RW Aurigae Type Stars and related Types.
International Astronomical Union Symposium No. 3, Non-stable Stars, p. 22.
2. C. Hoffmeister, Über das Verhalten von drei typischen und sechs atypischen RW
Aurigae-Sternen. Veröffentl. Sternwarte Sonneberg 3 Nr. 3, 1957.
3. H. Schneller, Geschichte und Literatur des Lichtwechsels der Veränderlichen
Sterne. Zweite Ausgabe. 3. Band p. V -IX, 1952.